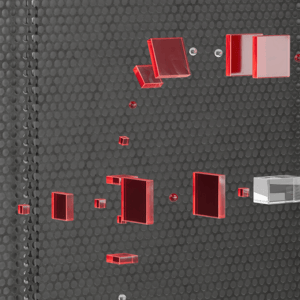
GlossarGlossar
Lesen Sie alles Wissenswerte über wichtige Begriffe rund um die digitale Signatur
In unserem Glossar erfahren Sie, für welche Dokumente in unterschiedlichen Branchen digitale Signaturen geeignet sind, wo sie eingesetzt werden können und welchen Nutzen sie bringen – verständlich zusammengefasst.
A - B
C - L
Ärzte, Arztpraxen und Kliniken können in ihrer Korrespondenz mit Krankenkassen seit Sommer 2016 auf die qualifizierte elektronische Signatur zurückgreifen, die sie über eine Signaturkarte und ein Kartenlesegerät (aufgrund der Kammerzugehörigkeit in der Regel über eine eigene Lösung der Ärztekammer) in digitale Dokumente integrieren können.
Angebote oder Kostenvoranschläge für Dienstleistungen verschiedenster Art oder auch Dienste von Handwerkern sind formfrei. Im Hinblick auf eine verbesserte Nachweismöglichkeit des ursprünglichen Kostenvoranschlages empfiehlt es sich, eine fortgeschrittene elektronische Signatur mit FP Sign zu verwenden, die vom Anbieter ausgestellt sowie vom Kunden bestätigt werden kann.
Ob eine Kündigung, also die Willenserklärung zur einseitigen Auflösung eines Vertrags, formbedürftig ist, hängt immer von dem jeweiligen rechtsgeschäftlichen Hintergrund ab (etwa dessen Zuordnung zum gesetzlichen Leitbild der Miete, des Arbeitsvertrages, eines Dienstleistungsvertrages etc.), oder von einer entsprechend wirksamen Parteivereinbarung (Individualvertrag oder auch AGB).
Es gibt jedoch Anwendungsfälle, die grundsätzlich von digitalen oder elektronischen Prozessen ausgeschlossen sind. Darunter fällt etwa auch die Kündigung von Arbeitsverhältnissen nach § 623 BGB. Die Substitution der Schriftform durch die elektronische Form per E-Mail, Fax oder auch elektronischer Signatur (gemäß § 126a BGB) ist dann ausgeschlossen.
Ein Leihvertrag liegt vor, wenn eine Sache unentgeltlich zum Gebrauch überlassen wird. Bei Ablauf oder Kündigung des Vertrags muss die entliehene Sache zurückgegeben werden. Sobald ein Entgelt verlangt wird, handelt es sich um einen Mietvertrag.
Ein Leihvertrag gemäß § 598 BGB benötigt keine spezielle Form. Der Einsatz einer fortgeschrittenen Signatur, beispielsweise mit FP Sign, erhöht Beweiskraft und Nachvollziehbarkeit des Dokuments.
Ein Leistungsprotokoll enthält eine Übersicht über erbrachte Dienste verschiedenster Art, beispielsweise Behandlungen, Reparaturen oder Service- und Kreativleistungen, die anschließend abgerechnet werden können. Eine solche Leistungsübersicht ist grundsätzlich formfrei. Der Einsatz einer fortgeschrittenen Signatur mit FP Sign empfiehlt sich, da dann nachträgliche Veränderung der Daten unter der Signatur erkannt werden können.
Auch ein Lizenzvertrag kann grundsätzlich formfrei abgeschlossen werden. Ein Lizenzvertrag in Schriftform, der mit mindestens einer fortgeschrittenen Signatur, beispielsweise über FP Sign, unterzeichnet wurde, hilft Lizenzgeber und Lizenznehmer eindeutig zu identifizieren und damit die Berechtigung ggf. nachweisen zu können.
M - S
U - Z
Es gibt eine Vielzahl von Vertragsarten, die mit unterschiedlichen Formvorschriften einhergehen. Wird die verlangte Form nicht eingehalten, ist der jeweilige Vertrag unwirksam. Ein Vertrag, der frei von jeder Form ist, ist als schriftliche Version inklusive einer fortgeschrittenen Signatur in der Regel rechtlich gültig. Formfreie Verträge sind zum Beispiel Dienstverträge, Kaufverträge über bewegliche Sachen, Leihverträge, Mietverträge (nicht von Wohnraum!), Pachtverträge, Sachdarlehensverträge, Tauschverträge und Werkverträge.
Wird für einen Vertrag explizit die Schriftform verlangt, kann – soweit dies nicht gesetzlich ausgeschlossen ist - eine qualifizierte elektronische Signatur verwendet werden, die die Schriftform ersetzt. Die Schriftform bzw. eine qualifizierte elektronische Signatur ist für folgende Vertragsarten vorgegeben: Bürgschaftsverträge, Darlehensverträge insbesondere Verbraucherdarlehen und Mietverträge für Wohnraum.
Für andere Vertragsarten gibt es wiederum unterschiedliche Formvorschriften z.B. beim Gesellschaftsvertrag.
Der Rechtsbegriff des „Widerspruchs“ im engen Sinne beschreibt entweder den Widerspruch gegen den Verwaltungsakt einer Behörde oder staatlichen Institution oder aber im zivilprozessualen Sinne den Widerspruch gegen einen ergangenen Mahnbescheid im Zuge eines angestrengten gerichtlichen Mahnverfahrens. Der Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt ist grundsätzlich schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben (siehe § 70 Abs. 1 VwGO); ein in elektronischer Form eingelegter Widerspruch ist indes möglich, soweit dies zum einen durch die Rechtsverordnung zugelassen worden ist und der konkrete Empfänger – d. h. die Behörde, an die der Widerspruch zu richten ist – hierfür einen Zugang eröffnet hat (siehe § 3a Abs. 1 VwVfG, diese Frage wird in den einzelnen Bundesländern noch unterschiedlich gehandhabt; gegebenenfalls ist eine vorherige Abklärung geboten). Zum anderen erfordert die Einlegung eines Widerspruchs per E-Mail eine qualifizierte elektronische Signatur (siehe § 55 a Abs. 1 S. 3 VwGO).
Für einen Einwand gegen die Entscheidung eines Unternehmens oder Vertragspartners (beispielsweise bei Änderung von Vertragskonditionen oder Preisen) ist hingegen meist – soweit nicht gesetzlich oder vertraglich anders bestimmt - ein einfaches Schreiben ausreichend, das mittels einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur, beispielsweise mit FP Sign, signiert wurde. Im Zweifel lohnt ein Blick in die Vertragsbedingungen.
Widersprüche gegen die Kündigung eines Mietverhältnisses (§ 574b Abs. 1 BGB) bedürfen hingegen in jedem Fall der Schriftform und somit einer qualifizierten elektronischen Signatur.
Grundlagen und rechtlicher Rahmen
-
Dieses Glossar erhebt aber weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch wird gewährleistet, dass diese Abhandlungen rechtlich zutreffend sind (oder bleiben). Wir empfehlen daher unbedingt, im Bedarfsfall anwaltlichen Rat einzuholen. Die Entscheidungsverantwortung liegt beim jeweiligen Unternehmen.
Unter einer „Signatur“ im vorliegenden Kontext versteht man ein ausgewiesenes Identifizierungs- bzw. Authentifizierungsmerkmal, das eine rechtsgeschäftliche Erklärung möglichst beweiskräftig einer bestimmten natürlichen Person als Aussteller zuordnen soll. Dabei ist zwischen der handschriftlichen Signatur unter einem verkörperten Schriftstück (Namenszeichen als „Unterschrift“) und einer „elektronischen Signatur“ (als ein kryptographisches Verfahren) zu unterscheiden. Unter bestimmten, d. h. gesetzlich oder vertraglich definierten Umständen kann eine elektronische Signatur die handschriftliche entweder ersetzen – oder dies aufgrund zwingender gesetzlicher Formvorschriften grundsätzlich ausschließen.
Nach deutschem Recht zu unterscheiden sind die Schriftform (§ 126 BGB), die öffentliche Beglaubigung (§ 129 BGB) und die notarielle Beurkundung (§ 128 BGB). Von diesen kann grundsätzlich nur die gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Form durch die elektronische Form (§ 126a BGB) ersetzt werden, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt (siehe etwa § 109 Abs. 3 GewO). Kann die gesetzlich vorgeschriebene Schriftform durch die elektronische Form ersetzt werden, muss der Aussteller der Erklärung seinen Namen hinzufügen und das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur (nach dem Signaturgesetz) versehen.
Neben der „qualifizierten“ Form unterscheidet man auch noch die „einfache“ und die „fortgeschrittene“ Form der elektronischen Signatur. Während für die einfache elektronische Signatur bereits die simple Nennung des Erklärenden in Textform (etwa am Ende einer E-Mail) ohne weitere Authentifizierung ausreichend ist, muss die fortgeschrittene elektronische Signatur (§ 2 Nr. 2 Signaturgesetz) mit einem einmaligen Signaturschlüssel erstellt werden, der einem bestimmten Inhaber zugeordnet ist. Dieser eindeutig identifizierbare Signaturschlüssel-Inhaber hat die alleinige Kontrolle über die Erzeugung der Signatur und Änderungen am Erklärungsinhalt unter dieser Signatur können erkannt werden.
Zur Wahrung einer durch Rechtsgeschäft bestimmten schriftlichen Form genügt (soweit nicht ein anderer Wille aufgrund besonderer Umstände anzunehmen ist), die „telekommunikative Übermittlung“, also eine einfache Signatur (siehe § 127 Abs. 2 BGB; also etwa E-Mail oder Fax). Eine E-Mail mit einfacher Signatur ist als bloße Textform aber kein sog. „Strengbeweis“. Im Rahmen eines Gerichtsverfahrens unterliegen zwar auch einfache Signaturen der freien richterlichen Beweiswürdigung, allerdings sollten Vertragsparteien für wichtige rechtsgeschäftliche Erklärungen, die nicht in Schriftform abgegeben werden, die fortgeschrittene elektronische Signatur verwenden. Dieser kommt dann eine erhöhte Beweiskraft vor Gericht zu.
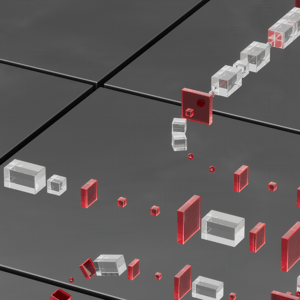
Kontaktieren Sie unser Team
Sie möchten FP Sign kennenlernen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
